
Green Marketing neu gedacht: Warum 60 % Potenzial ungenutzt bleiben
Nachhaltigkeit ist heute einer der wichtigsten Treiber des Konsumverhaltens. Kaum eine Marke, die nicht mit grünem Marketing oder einer nachhaltigen Markenstrategie wirbt. Und doch zeigt sich eine deutliche Lücke: Das, was Konsumenten über Nachhaltigkeit sagen, stimmt selten mit ihrem tatsächlichen Verhalten überein. Dieses Phänomen ist als Attitude-Behaviour-Gap bekannt – und es kostet Unternehmen bares Geld.
Eine aktuelle Diskussion im “brand eins”-Podcast mit Johanna Gollnhofer, Autorin von “Das 60%-Potenzial”, macht deutlich: Wer im Marketing nur auf die klassischen Öko-Fans setzt, übersieht die mit Abstand größte Gruppe und damit ein Umsatzpotenzial von 60%.

Was ist das 60%-Potenzial?
Umfragen zufolge würden 60% der deutschen Konsumenten mehr Geld für nachhaltige Produkte ausgeben. In der Praxis sieht es jedoch oft anders aus: Bio-Lebensmittel landen seltener im Einkaufswagen, das Auto ist nach wie vor attraktiv, und Urlaubsflüge sind fest eingeplant.
Johanna Gollnhofer unterscheidet hierbei in drei Gruppen:
- Die Öko-Fans: Strikte Bio-Käufer, die konsequent nachhaltig konsumieren. Für sie ist Green Marketing kein Verkaufsargument, sondern eine Grundvoraussetzung.
- Die 60%-Gruppe: Menschen, die nachhaltiger leben wollen, aber oft pragmatisch handeln. Sie reduzieren den Fleischkonsum, verzichten aber nicht vollständig darauf. Urlaubsflüge sind erlaubt. Für sie bedeutet „Nachhaltigkeit“ oft auch Verzicht, Vernunft und Einschränkung, also Begriffe mit negativer Konnotation.
- Die Öko-Muffel: Konsumenten, die Nachhaltigkeit grundsätzlich ablehnen. Hier lohnt sich Marketing kaum, da keine Kaufbereitschaft besteht.
Das Problem dabei ist, dass sich Marketingkampagnen häufig auf die Öko-Fans, also die ohnehin Überzeugten, fokussieren. Die große Mitte, die 60-Prozent-Gruppe, wird hingegen kaum erreicht.
Warum Marketing an 60% vorbeigeht?
Viele Unternehmen – von Drogeriemärkten bis zu Automobilherstellern – richten ihre Nachhaltigkeitskampagnen so aus, dass sie besonders „grün“ wirken. Das überzeugt zwar die Öko-Fans, schreckt aber die pragmatischen 60 Prozent ab.
Ein Beispiel: Der BMW i3 wurde als sichtbar nachhaltiges Elektroauto positioniert. Das Marketing erinnerte stark an das der Nischen-Öko Marken. Ergebnis: Die breite Kundschaft von BMW fühlte sich nicht angesprochen. Das Modell blieb ein Flop.
Tesla vermarktet seine Autos ganz anders: Zwar ist Elektromobilität an sich nachhaltiger, doch Tesla setzt nicht auf Klimaschutz, sondern auf Modernität, Innovation und Lifestyle. Nachhaltigkeit war hier ein Nebenprodukt und kein Alleinstellungsmerkmal. Genau das machte Tesla bei 60 Prozent der Kunden erfolgreich.

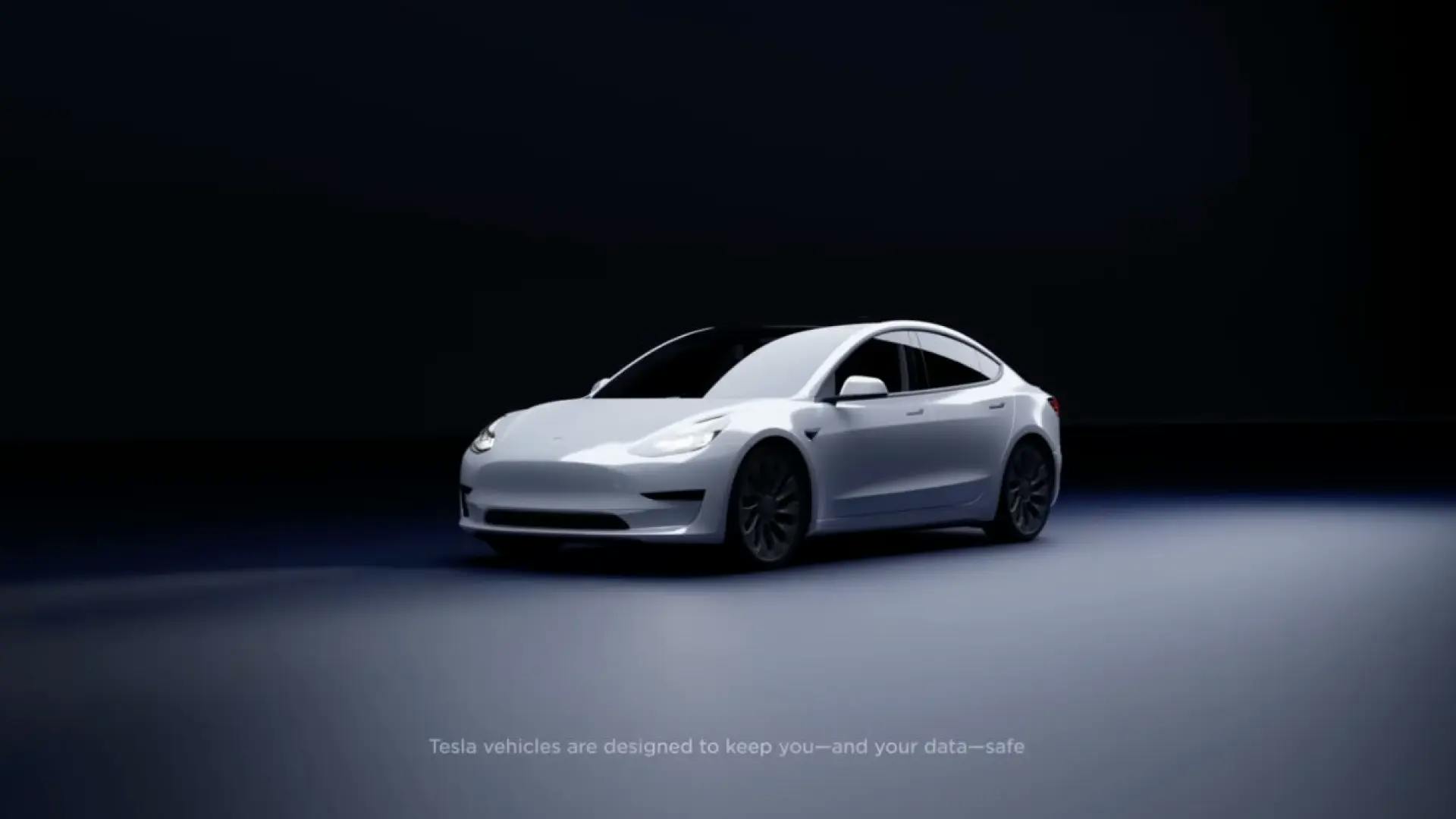
Green Branding statt Greenwashing
Ein weiteres Hindernis ist, dass Nachhaltigkeit kein Differenzierungsmerkmal mehr ist.
Inzwischen behaupten fast alle Unternehmen, nachhaltig zu sein. Das hat zwei Auswirkungen:
- Verlust an Glaubwürdigkeit: Konsumenten verbinden Nachhaltigkeit zunehmend mit Greenwashing.
- Verlust an Differenzierung: Wenn alle „nachhaltig“ sind, hebt sich keine Marke mehr ab.
Die Folge ist, dass insbesondere die 60%-Gruppe Nachhaltigkeit mit Verzicht, Einschränkung und Misstrauen assoziiert.
Lösung: Emotionale Alleinstellungsmerkmale
Um diese Zielgruppe zu erreichen, reicht das Argument der „Nachhaltigkeit“ nicht aus. Marken müssen emotionale Gründe bieten, die über die Vernunft hinausgehen.
- Vergnügen statt Verzicht: Genuss, Lifestyle und Komfort sollten im Vordergrund stehen.
- Es sollten positive Zukunftsbilder statt mahnender Symbole wie Eisbären auf schmelzenden Eisschollen gezeigt werden.
- Beim Green Branding wird Nachhaltigkeit als „selbstverständlicher“ Wert präsentiert und nicht als moralischer Zeigefinger.
Die Rolle der „Sustainable Immigrants“
Marken wie Patagonia, Oatly oder Tesla sind sogenannte „Sustainable Immigrants“: Sie sind nicht in der Öko-Nische gestartet, haben Nachhaltigkeit aber von Anfang an integriert. Ihre Produkte sind teurer – und trotzdem erfolgreich. Warum? Weil Konsumenten hier primär Marke und Lifestyle kaufen.
Ein Beispiel ist Oatly: Die Käufer zahlen mehr für Hafermilch, weil sich das Unternehmen als cooler, urbaner Lifestyle-Brand positioniert – nicht, weil sie unbedingt nachhaltiger leben wollen.
Das zeigt: Marke schlägt Preis – und Preis schlägt Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit wirkt am stärksten als Zusatz-Argument, nicht als Hauptargument.

Warum sind 60% der Umsatzhebel?
Die pragmatische Mitte ist für Unternehmen, die Umsatz und Nachhaltigkeit verbinden wollen, die entscheidende Zielgruppe.
- Flexibilität: Die 60% sind bereit, nachhaltiger zu konsumieren, aber nicht kompromisslos.
- Größe: Mit über der Hälfte der Bevölkerung stellen sie den größten Markt dar.
- Pragmatismus: Wer Nachhaltigkeit attraktiv, einfach und genussorientiert kommuniziert, gewinnt diese Gruppe.
Statt Kampagnen nur auf die Öko-Fans auszurichten, sind Marketingstrategien gefragt, die Freude, Einfachheit und Lifestyle betonen.
Erfolgreiche Marketingstrategien für nachhaltige Marken
- Storytelling statt Moralpredigt: Erzähle Geschichten, die emotional mitreißen und nicht nur rational überzeugen.
- Lifestyle-Positionierung: Inszeniere Nachhaltigkeit als Nebeneffekt einer modernen, zukunftssicheren Marke (wie Tesla).
- Vertrauen durch Transparenz: Kommuniziere klare, überprüfbare Nachhaltigkeitsmaßnahmen, um Greenwashing-Vorwürfe zu vermeiden.
- Pragmatische Angebote: Produkte so gestalten, dass sie im Alltag leicht nutzbar sind, ohne dass der Eindruck von Verzicht entsteht.
- Positive Assoziationen schaffen: Nachhaltigkeit mit Spaß, Genuss und Lebensqualität verbinden.
Warum sind Umsatz und Nachhaltigkeit kein Widerspruch?
Das Narrativ „ökologisch vs. ökonomisch“ hält sich hartnäckig. Doch die Beispiele zeigen: Nachhaltigkeit und Umsatz schließen sich nur dann aus, wenn die 60%-Gruppe ignoriert wird.
- Wer nur die Öko-Fans bedient, wächst nur in einer Nische.
- Wer die Öko-Muffel überzeugen will, verschwendet Ressourcen.
- Wer hingegen die 60 % adressiert, hat die Chance, nachhaltigen Konsum massentauglich und wirtschaftlich erfolgreich zu machen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das 60%-Potenzial im nachhaltigen Marketing?
Es beschreibt die größte Konsumentengruppe in Deutschland: Menschen, die nachhaltiger konsumieren möchten, aber oft pragmatisch handeln. Diese Gruppe ist für den Markterfolg entscheidend.
Was ist der Attitude-Behaviour-Gap?
Er bezeichnet die Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten. Viele Konsumenten sagen, sie würden nachhaltig konsumieren, handeln im Alltag aber nicht entsprechend.
Warum war das Marketing für den BMW i3 ein Fehler?
Weil es sich stark an Öko-Fans orientierte und dadurch die breite Masse der Konsumenten nicht erreichte.
Warum ist Tesla ein Beispiel für erfolgreiches Green Branding?
Weil Tesla Nachhaltigkeit nicht als Hauptargument nutzt, sondern als Nebenprodukt einer modernen, zukunftsorientierten Marke inszeniert.
Wie können Marken die 60%-Gruppe überzeugen?
Durch Storytelling, eine Lifestyle-Positionierung, transparente Kommunikation und eine positive emotionale Aufladung von Nachhaltigkeit.
Von der Pflicht zur Kür
Nachhaltigkeit ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr, sondern eine Pflicht-Voraussetzung. Erfolgreiches Green Marketing beginnt dort, wo Nachhaltigkeit in eine inspirierende und lustvolle Markenwelt eingebettet wird.
Die zentrale Frage lautet:
Wie schaffen es Marken, die pragmatischen 60 % emotional zu erreichen? Die Antwort liegt in Lifestyle, Vertrauen und Erlebniswert, nicht in Verzicht und Moral.
Über Werk 8
Werk 8 ist eine Digitalagentur aus Ludwigsburg (in der Nähe von Stuttgart). Wir entwickeln digitale Lösungen, die Nutzer*innen begeistern, Marken stärken und Emotionen wecken. In unseren Projekten vereinen wir strategische Beratung, Kreativität, technologische Expertise, Content Creation und den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI).
Ob barrierefreie Website, performante Plattform oder skalierbare E-Commerce-Lösung – unser Team entwickelt individuelle digitale Produkte, die auf allen Endgeräten funktionieren und ein echtes Nutzererlebnis schaffen. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus der Industrie, dem Handel, der Lebensmittelbranche, dem Finanzwesen sowie dem Sport- und Eventbereich.
